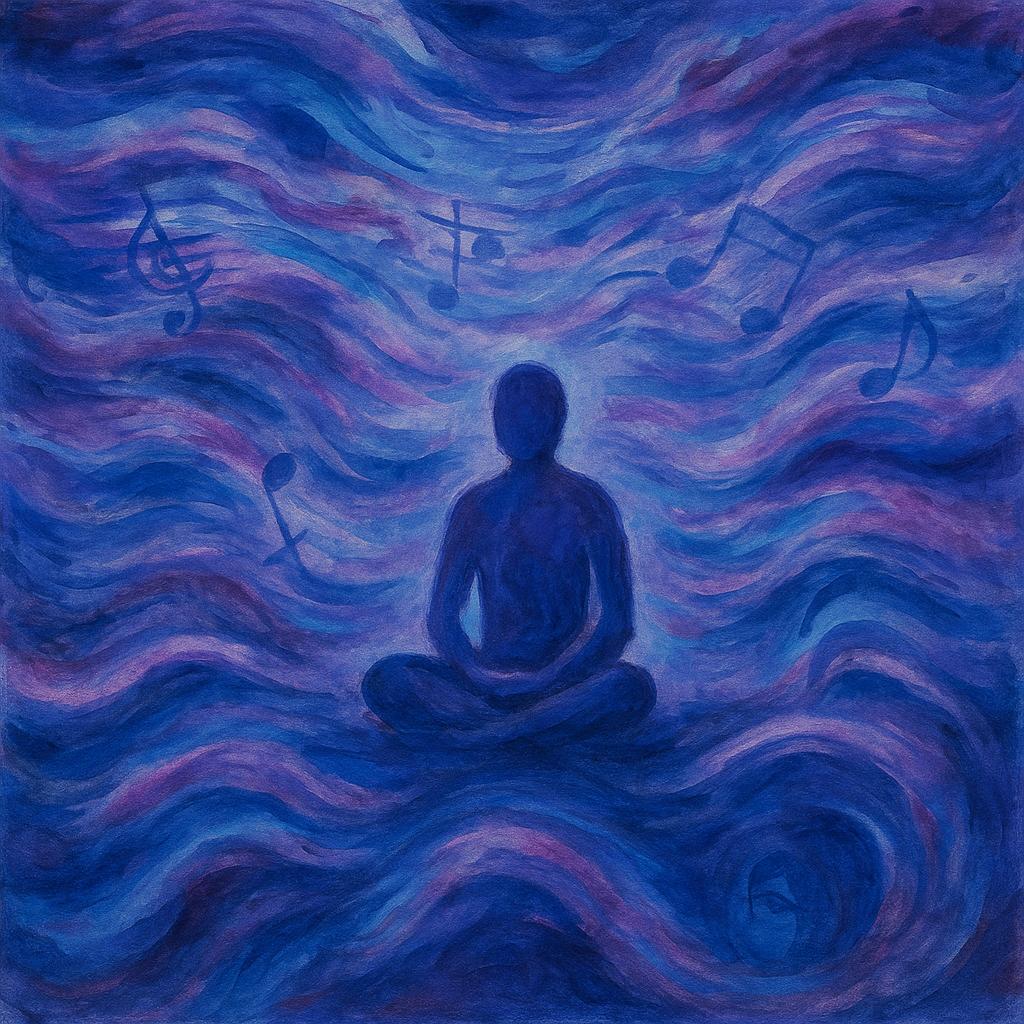Ich stehe am Morgen vor meinem Klavier, den Blick noch halb in der Dämmerung, und erinnere mich an jene Zeilen, die das Ungewisse feiern: ich weiß nicht, wie dieser Tag sich wendet. In diesem Moment beginnt für mich jede musikalische Arbeit als ein dialogisches Geschehen, in dem Form und Freiheit in einem ständigen Wechselspiel stehen. Ich habe gelernt, dass Komposition nicht allein das Anlegen starrer Gerüste bedeutet, sondern das bewusste Einlassen auf Prozesse, die sich im Augenblick entfalten, wie ein Fluss, der an keiner Stelle stillsteht.
Wenn ich improvisiere, lasse ich mich auf das Wesentliche ein: auf Resonanzen im Raum, auf die leisen Schwingungen meiner eigenen Atmung, auf jede Nuance im Klang. Ich schaffe keine vorgezeichneten Linien, sondern betrachte jede Geste als Frage und Antwort zugleich. Meine Hand auf der Tastatur wird zum Instrument des Lauschens. Ich höre nicht nur, was mein Instrument von sich gibt, sondern höre in mich hinein, lausche den Impulsen, die aus einem Ort jenseits bewussten Planens erwachsen. Auf diese Weise entsteht Musik als Prozess, der sich in jedem Augenblick neu erfindet.
In der Komposition folge ich manchmal jenem Prinzip, das in der japanischen Ästhetik als Jo–Ha–Kyū bekannt ist: eine stille Einführung, eine Öffnung durch Variation und schließlich eine beschleunigte Verdichtung. Ich beginne in der Stille, halte Motive vage, lasse Parameter offen – etwa die Tonhöhe einer Phrase oder das Tempo einer Passage. Ich notiere nicht, um Festlegungen zu treffen, sondern um Möglichkeiten anzuregen. So bleibt die Partitur lebendig. Wenn ich sie später interpretiere oder andere Musiker damit arbeiten, entsteht ein fortwährender Dialog zwischen Notation, Raum und Klanggestaltung.
Ich erinnere mich an eine Sitzung, in der ich nur Fragmente aufgeschrieben hatte. Die Spielerinnen und Spieler näherten sich den Zeilen, als wären es Hinweise auf eine Landschaft, deren Konturen wir gemeinsam ausformten. Was ich nicht niedergelegt hatte, ergab sich aus dem Zusammenspiel der Stimmen. Die Partitur erwies sich als Einladung, nicht als Auftrag. Dieses Nichtwissen, das bewusst gewählte Offenlassen von Elementen, begreife ich als kreative Methode: Es schafft Raum für Überraschung und lässt Klänge aufscheinen, von denen ich zuvor nicht ahnte, dass sie existierten.
Ein zentrales Element ist dabei die Stille – nicht als Abwesenheit, sondern als Resonanzraum. In vielen Traditionen, etwa bei der japanischen Shō-Improvisation, ist das Schweigen zwischen den Tönen mindestens so wichtig wie der Ton selbst. Ich übe mich im Hören des „Ma“, jenes Zwischenraums, der Spannung, Erwartung und Nachklang zugleich birgt. Wenn ich in einer Komposition Pausen einräume, lasse ich Klang und Schweigen in einem dynamischen Wechselspiel stehen. Die Stille wird zur Leinwand, auf der jeder Ton nachklingen kann, bevor er erneut verwischt.
In meiner Praxis beschäftige ich mich zudem mit aleatorischen Verfahren: ich werfe etwa Würfel, um Parameter zu bestimmen, oder lasse externe Zufallsquellen in den Arbeitsprozess einfließen. Dabei erlebe ich immer wieder, wie der Zufall mir Töne zuspielt, die ich nie bewusst gewählt hätte. Diese Momente lehren mich, Kontrolle loszulassen und mich auf das Unerwartete einzulassen. Ich betrachte sie nicht als Störung, sondern als Bereicherung – als Einladung, meine eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen und Klangmöglichkeiten zu erkunden, die jenseits rationaler Planung liegen.
Wenn ich über Erwartung und Überraschung nachdenke, denke ich an die Arbeit der Hörpsychologinnen und –psychologen, die belegen, dass Spannung zwischen dem Erwarteten und dem Tatsächlichen entsteht. In meinen Stücken spiele ich mit diesen Mechanismen: eine vertraute Phrase, die plötzlich in einer unerwarteten Harmonie aufbricht, oder ein Rhythmus, der sein Muster just in dem Moment unterläuft, in dem der Hörer ihn erkannt zu haben glaubt. So entwerfe ich Klanglandschaften, in denen immer wieder neue Perspektiven auftauchen, und der Hörer aktiv im Jetzt präsent sein muss.
Das Interpretieren eines Stücks verstehe ich als fortwährenden Akt des Lauschens. Wenn ich mein eigenes Werk oder das eines anderen spiele, höre ich nicht nur die Töne, sondern versuche, das Unausgesprochene, das Meistimmige wahrnehmbar zu machen. Technik allein genügt nicht; es braucht Empfänglichkeit für die Impulse, die im Raum entstehen, für die Mikrovariationen zwischen den Noten, für die Wechselwirkung zwischen Klangkörpern, Raumakustik und Stille.
In Proben setze ich bewusst Zeiten für gemeinsames Hören an. Wir spielen Fragmente, halten inne, hören zu, reflektieren und setzen erneut an. Dieses kollektive Lauschen verändert den Blick auf das Gespielte. Jeder Musiker wird zum Mitgestalter, und das Ensemble wird zum Raum für klangliche Erkundung.
Am Ende jeder Session steht kein letztes Ziel, sondern der Moment, in dem Klang und Schweigen im Raum nachhallen. Ich gehe nicht mit dem Wissen, das Werk sei abgeschlossen, sondern spüre, dass jede Darbietung nur eine von vielen möglichen Versionen ist. Die Musik lebt weiter in der Erinnerung, in Nachklängen und in dem, was sie in jedem Einzelnen auslöst.
So verstehe ich musikalische Praxis: als kontinuierliches Offenhalten, als Hören im Ungewissen und als Teilhabe an einem Prozess, in dem ich mich selbst immer wieder neu entdecke. Die Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton, sie beginnt mit dem ersten Lauschen, und sie endet nie endgültig, weil sie in jedem Augenblick des Lauschens neu geboren wird.